Zittern, Bewegungsarmut und Muskelsteifheit sind die Hauptsymptome des Parkinson-Syndroms. „Vor allem bei einseitigem Zittern in Ruhe sowie bei unsicherem Gang und dadurch erhöhtem Sturzvorkommen sollten Betroffene unbedingt eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für Neurologie aufsuchen“, rät Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolf Müllbacher, Abteilungsvorstand der Neurologie im Göttlicher Heiland Krankenhaus.
Neben diesen typischen Anzeichen für die früher als „Schüttellähmung“ bezeichnete Erkrankung gibt es aber auch Frühwarnzeichen, die Betroffene oft weniger damit in Verbindung bringen. „Bereits Jahre vor den motorischen Einschränkungen können Parkinson-Patientinnen und -Patienten an Symptomen wie Riech- und daraus resultierenden Geschmacksstörungen, Verdauungsstörungen [meist Verstopfung] sowie der so genannten REM-Schlaf-Verhaltensstörung leiden“, gibt Müllbacher zu denken. Bei dieser haben Betroffene häufig lebhafte Träume, treten, schlagen und schreien im Schlaf. Auch Depressionen und Angststörungen, Konzentrationsschwäche und kognitive Veränderungen können hinzukommen.
Dopamindefizit als Ursache
Zur Diagnose wird nach der Anamnese eine klinische Untersuchung der typischen Trias durchgeführt: Rigor [Muskelsteifheit] – Tremor [Zittern] – Akinese [Bewegungsarmut]. Zusätzlich wird eine Bildgebung des Kopfes durchgeführt. Der so genannte DAT-Scan zeigt, ob ein Dopamindefizit in einer bestimmten Hirnregion – dem Striatum – besteht. Das lässt sich mit der SPECT-Untersuchung nuklearmedizinisch gut darstellen. Der L-Dopa-Test bestätigt oder widerlegt die Verdachtsdiagnose. „Parkinson-Patientinnen und -Patienten werden in erster Linie mit der Gabe von Dopamin behandelt. Spricht ein•e Patient•in auf die Gabe von Dopamin gut an, dann gilt die Diagnose Parkinson als bestätigt“, erklärt Müllbacher.
Differentialdiagnosen wie Gefäßveränderungen und Durchblutungsstörungen, die eine ähnliche Symptomatik auslösen können, müssen im MRT [Magnetresonanztherapie] ausgeschlossen werden.
Prognose und Verlauf
Ob ein•e Parkinson-Patient•in eine leichte oder schwere – das heißt schneller fortschreitende Art der Erkrankung zu erwarten hat, lässt sich beim einmaligen Arztbesuch laut Müllbacher nicht sagen. „Man muss Patientinnen und Patienten zwei bis dreimal gesehen haben, um den Verlauf abschätzen zu können“, erklärt der Experte. Die Schwere des Morbus Parkinson beziehe sich immer auf die Ausprägung der Einschränkungen durch die Symptome.
Das Problem ist, dass es sich bei Morbus Parkinson um eine degenerative Erkrankung handelt. Bei der symptomatischen Therapie wird das Dopamin, was die bereits zugrunde gegangenen Nervenzellen produziert hätten, in Tablettenform ersetzt. „Durch das Fortschreiten der Degeneration kann sich die Erkrankung trotz Medikation weiter verschlechtern“, sagt Müllbacher.
Additive Therapiemaßnahmen
Für die Erhaltung der Mobilität und eine Verbesserung der Lebensqualität spielt Physiotherapie eine wichtige Rolle in der Therapie Parkinson-kranker Menschen. Regelmäßiges Training verbessert die Muskelspannung und wirkt nachweislich als Prophylaxe von Sekundärstörungen durch Bewegungsmangel. Ergotherapie wird eingesetzt, um die Selbständigkeit Betroffener zu erhalten und um Feinmotorikstörungen zu behandeln. Bei Einschränkungen der Stimmbildung sowie Sprech- und Schluckstörungen erzielt die Logopädie mit Parkinson-Erkrankten gute Erfolge.
Häufigkeit und unterschiedliche Ausprägungen von Morbus Parkinson
Weltweit leiden Schätzungen zufolge zehn Millionen Menschen an Parkinson. In Österreich leben zirka 20.000 Personen mit der Diagnose. Männer sind etwa 50 Prozent häufiger betroffen als Frauen. In der Regel tritt das Morbus Parkinson-Syndrom nach dem 60. Lebensjahr auf. In zirka fünf bis zehn Prozent der Fälle beginnt die Krankheit bereits vor dem 50. Lebensjahr als so genanntes Young Onset-Parkinson-Syndrom.
Das idiopathische Parkinson-Syndrom ist die häufigste Form der Erkrankung, an der 80-85 Prozent der Betroffenen leiden. Die restlichen 15 bis 20 Prozent erkranken an atypischen Parkinson-Syndromen, die häufig eine schwierigere Prognose haben und bei denen die Basismedikation nicht immer vergleichbare Erfolge erzielt.
Göttlicher Heiland Krankenhaus – Fachklinik mit Spezialisierung auf Altersmedizin
Das Göttlicher Heiland Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit multiprofessionellem Gefäßzentrum, Kardiologie inkl. Herzüberwachungsstation und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfall spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie, als auch Plastische und Rekonstruktive Chirurgie und führt ein Adipositas- und Lymphologie Zentrum. Die Akutgeriatrie/ Remobilisation und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt.

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen
Die Vinzenz Gruppe ist eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Von der Prävention, über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation begleiten wir die Menschen in allen Lebensphasen mit einem vielfältigen Angebot und innovativen neuen Lösungen. 1995 von Ordensfrauen mit langer Tradition und Erfahrung in der Krankenpflege gegründet, verbinden wir tief verwurzelte christliche Werte mit jeder Menge Innovationsgeist, um die Gesundheitsversorgung Österreichs in Zeiten der Veränderung ganzheitlich weiterzuentwickeln.
Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe.
(Bilder: AdobeStock, Göttlicher Heiland Krankenhaus, AdobeStock)
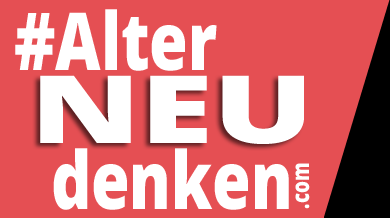










![Demenz: Es braucht [viel] mehr leistbare Unterstützungsangebote! Grafik: der Umriss eines Kopfes mit quadratischen Holzteilen, von denen einige nach hinten "wegfliegen". (c) AdobStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2025/09/demenz-angebote-home-450x253.jpg)

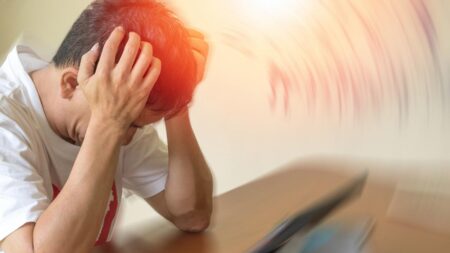


























![Zukunftsvisionen: Vielfältige Einsatzgebiete von Künstlicher Intelligenz [KI] in den kommenden Jahren Ein menschlich anmutender Roboter, der ein großes virtuelles Touchpad bedient. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2024/09/ki-zukunft_home-450x253.jpg)












